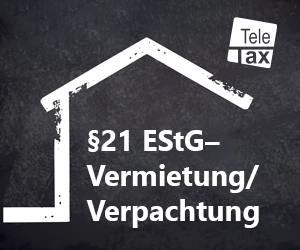27.05.2021 | Fachartikel
Die insolvenzrechtlichen Änderungen im Überblick
Von Thomas Uppenbrink, Insolvenzverwalter und Sanierungsberater
Neben der Einführung des Gesetzes über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) und des damit einhergehenden präventiven Restrukturierungsverfahrens, wird im Zuge des Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetzes (SanInsFoG) auch die Insolvenzordnung angepasst. Der folgende Fachartikel gibt einen Überblick über die für die Praxis wichtigen Änderungen.
Änderung der Insolvenzantragsgründe

Die Einführung eines vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens macht eine deutliche Differenzierung zwischen der drohenden Zahlungsunfähigkeit und der Überschuldung notwendig. Denn die drohende Zahlungsunfähigkeit ist die Eintrittshürde für eine vorinsolvenzliche Sanierung gemäß StaRUG. Liegt eine Überschuldung vor, wird dieses Verfahren wieder beendet.
Die für die Liquiditätsvorschau geforderten Prognosezeiträume für Überschuldung und drohende Zahlungsunfähigkeit werden daher wie folgt im Rahmen des SanInsFoG durch Änderungen der §§ 18 und 19 InsO ausdifferenziert:
- Drohende Zahlungsunfähigkeit: 24 Monate
- Fortbestehensprognose i. R. d. Überschuldung: 12 Monate.
Pflichten der Geschäftsleitung
Bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung sind Geschäftsleiter*innen zur Insolvenzantragsstellung verpflichtet. Bei besonderen Umständen ist durch den Zusatz „in der Regel“ davon auszugehen, dass in der Praxis auch abweichende Zeiträume möglich sind. Liegt jedoch eine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit vor, sind die Geschäftsleiter*innen haftungsbeschränkter Gesellschaften auch weiterhin zur Insolvenzantragsstellung verpflichtet.
Zusätzlich wird die Frist zur Stellung des Insolvenzantrages bei einer Überschuldung von drei auf dann sechs Wochen verlängert. So soll eine rechtzeitige Beseitigung der Überschuldung ermöglicht werden. Diese Frist steht jedoch nach wie vor nur zur Verfügung, wenn davon auszugehen ist, dass die Überschuldung innerhalb der sechs Wochen zu beseitigen ist. Für das Jahr 2021 ist mit § 4 des COVInsAG jedoch eine Übergangsregelung vorgesehen, hier gilt der Überschuldungsbegriff nur abgeschwächt.
Dazu wird der Zeitraum für die Fortbestehensprognose für besonders von der Pandemie getroffene Unternehmen, bei Vorliegen bestimmter Umstände, auf vier Monate verkürzt. Unter den gleichen Voraussetzungen ermöglicht § 6 COVInsAG den eigentlich ausgeschlossenen Zugang zum Schutzschirmverfahren, auch wenn der Schuldner bereits zahlungsunfähig ist.
Zuständigkeit der Insolvenzgerichte – Vorgespräche möglich
Die Gerichte werden zentralisiert und zusätzliche Amtsgerichte können zu Insolvenzgerichten ernannt werden.
Die Möglichkeit Vorgespräche mit dem Insolvenzgericht zur erfolgreichen Durchführung von eigenverwalteten Insolvenzverfahren zu führen, bestand bereits, wurde nun jedoch im Gesetz unter § 10 a InsO aufgenommen. Ziel ist es, Bedenken im Vorhinein zu beseitigen und das geplante Konzept vorab zu erläutern.
Mit Inkrafttreten des SanInsFoG besteht nun durch § 10 a InsO für Schuldner*innen, mit einer Größenordnung, bei der ein obligatorischer Gläubigerausschuss einzusetzen ist, an dem für sie zuständigen Gericht, ein Anspruch auf ein solches richterliches Vorgespräch. Besteht dieser gesetzliche Anspruch nicht, liegt die Möglichkeit eines solchen Vorgesprächs im Ermessen des Gerichts.
Geben Schuldner*innen ihre Zustimmung, kann das Gericht nun nach § 10 a Abs. 2 InsO auch Gläubiger*innen anhören, um deren Bereitschaft zu eruieren, in den vorläufigen Gläubigerausschuss einzutreten. Die Abteilung, für die der/die Richter*in das Vorgespräch führt, ist dann in den sechs Monaten nach dem Vorgespräch für das Insolvenzverfahren zuständig.
Regelungen zur Verwalterbestellung
Im beschlossenen Gesetz ist klar geregelt, dass Restrukturierungsberater*innen oder Sanierungsmoderator*innen in der gleichen Sache zum/zur Insolvenzverwalter*in bestellt werden können, wenn
1. der Schuldner zwei der drei Voraussetzungen des § 22 a InsO erfüllt:
- mind. 6.000.000 Euro Bilanzsumme nach Abzug eines auf der Aktivseite ausgewiesenen Fehlbetrags im Sinne des § 268 Abs. 3 des HGB
- mind. 12.000.000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag
- im Jahresdurchschnitt mindestens fünfzig Arbeitnehmer
2. der vorläufige Gläubigerausschuss zustimmt.
Auch sonst gilt gemäß § 56 a InsO Gläubigerbeteiligung bei der Verwalterbestellung, wobei hier nicht alle Regelungen unbekannt sind:
- Anhörung des vorläufigen Gläubigerausschusses, es sei denn das Gericht sieht mit Rücksicht auf eine nachteilige Veränderung der Vermögenslage des Schuldners von einer Anhörung ab und begründet diese schriftlich.
- Der vorläufige Gläubigerausschuss kann dem Gericht einstimmig einen Vorschlag zur Person des Verwalters machen, von dem nur abgewichen werden kann, wenn diese Person für das Amt nicht geeignet ist.
- Der vorläufige Gläubigerausschuss kann in seiner ersten Sitzung einstimmig eine andere Person als die bestellte zum Insolvenzverwalter wählen.
Das Gericht kann anordnen, dass der Sachwalter den Schuldner bei der Insolvenzgeldvorfinanzierung, bei Verhandlungen oder der insolvenzrechtlichen Buchhaltung unterstützt. Neu ist zudem, dass, wenn der Insolvenzverwalter nachweislich nicht unabhängig (vorbefasst) ist, nun auch Gläubiger oder Schuldner innerhalb von sechs Monaten nach Bestellung dessen Entlassung beantragen können.
Neuregelungen des Eigenverwaltungsverfahrens
Für das Insolvenzplanverfahren besteht nun die Möglichkeit, gruppeninterne Drittsicherheiten gegen eine angemessene Entschädigung in den Plan miteinzubeziehen. Dabei handelt es sich um die Rechte der Inhaber*innen von Forderungen von gruppenzugehörigen Unternehmen.
Eingeführt wurde diese Regelung, um das Insolvenzverfahren nicht hinter das Restrukturierungsverfahren zu stellen, denn auch hier können gruppeninterne Drittsicherheiten miteinbezogen werden.
Drittsicherheiten bilden jedoch keinen Bestandteil der Insolvenzmasse, ein Eingriff in diese Rechte ist daher zur Erreichung des Zwecks eines Insolvenzplanverfahrens nicht zwangsläufig erforderlich.
Umsatzsteuerverbindlichkeiten und Sondersteuern
Umsatzsteuerverbindlichkeiten und ähnliche Verbindlichkeiten gelten, nachdem sie im RegE nicht aufgeführt waren, fortan nun doch gem. § 55 Abs. 4 S. 1 InsO als Masseverbindlichkeiten. Sie werden somit im eröffneten Verfahren als Masseverbindlichkeiten privilegiert und nach § 53 InsO vorab befriedigt.
Dies gilt gem. § 55 Abs. 2 S. 2 InsO ebenso für sonstige Ein- und Ausfuhrabgaben, bundesgesetzlich geregelte Verbrauchssteuern, die Luftverkehr- und die Kraftfahrzeugsteuer und die Lohnsteuer.
Auch die Haftung der Organvertreter in der Eigenverwaltung wurde neu geregelt, danach haften nach § 267 a InsO i.V.m. § 60 InsO Organvertreter wie ein Insolvenzverwalter und zwar bereits im Zuge der vorläufigen Eigenverwaltung.
Ebenfalls praxisrelevant ist, dass schon der vorläufige Gläubigerausschuss dem vorläufigen Sachwalter (oder auch dem Schuldner) einen Auftrag zur Ausarbeitung eines Insolvenzplans erteilen kann.
Erweiterte Auflagen
Die Antragstellung im Zuge des eigenverwalteten Insolvenzfahrens setzt nun ausführlichere Unterlangen voraus. Neben dem Antrag auf Eigenverwaltung wird nun eine sogenannte Eigenverwaltungsplanung verlangt.
Diese umfasst nach § 270 a InsO:
- Liquiditätsplanung für 6 Monate.
- Konzept des Verfahrens inkl. Darstellungen zur Krise, dem Ziel des Verfahrens und die entsprechenden geplanten Maßnahmen.
- Darstellung des Verhandlungsstandes mit den Gläubigern, beteiligten Dritten zu den Maßnahmen.
- Darstellung der Vorkehrungen, die der Schuldner getroffen hat, um seine Fähigkeit sicherzustellen, insolvenzrechtliche Pflichten zu erfüllen.
Weiterhin ist folgendes durch den Schuldner zu erklären:
- Ob und in welchem Umfang er gegenüber welchen Gläubigern Verbindlichkeiten zu begleichen hat.
- Ob und in welchen Verfahren zu seinen Gunsten innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Antrag Vollstreckungs- oder Verwertungssperren nach diesem Gesetz oder nach dem StaRUG angeordnet wurden.
- Ob er für die letzten drei Geschäftsjahre seinen Offenlegungspflichten, insbesondere nach den §§ 325 bis 328 oder 339 HGB nachgekommen ist.
- Die Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung erfolgt im Regelfall, wenn die Voraussetzungen nach § 270 b Abs. 1 InsO erfüllt sind.
Die Eigenverwaltungsplanung darf nicht auf unzutreffenden Tatsachen beruhen. Es dürfen keine der in § 270 b Abs. 2 InsO genannten Umstände vorliegen, zum Beispiel Lohnrückstände, Verstoß gegen Offenlegungspflichten etc.
Liegen die nachfolgenden Umstände vor, erfolgt die Bestellung des vorläufigen Sachwalters gem. § 270 b Abs. 2 InsO nur, wenn trotz dieser Umstände zu erwarten ist, dass der Schuldner bereit und in der Lage ist, seine Geschäftsführung an den Interessen der Gläubiger auszurichten:
- Die Liquiditätsplanung weist eine fehlende Deckung auf.
- Die Eigenverwaltung ist laut Vergleichsrechnung teurer als die Regelverwaltung.
- Zahlungsrückstände bei bspw. Arbeitnehmern oder erhebliche Rückstände bei Sozialversicherungen.
- Anordnung einer Vollstreckungs- oder Verwertungssperre in den letzten drei Jahren.
- Verstoß gegen die Offenlegungspflichten.
Überleitungsvorschrift des SanInsFoG
Um einen möglichst organisierten Übergang der Regelungen zu treffen, sieht die Überleitungsvorschrift vor, dass Insolvenzverfahren, die vor dem 01.01.2021 beantragt wurden gem. Art 103 m EGInsO, den bis dahin geltenden Vorschriften unterliegen.
Über den Autor: Thomas Uppenbrink ist Insolvenzverwalter und Sanierungsberater. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Thomas Uppenbrink & Collegen GmbH in Hagen (www.uppenbrink.de) und außerdem Inhaber der Autax-Consilium – Weiterbildung für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. E-Mail: info@uppenbrink.de.
Thomas Uppenbrink ist Insolvenzverwalter und Sanierungsberater. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Thomas Uppenbrink & Collegen GmbH in Hagen (www.uppenbrink.de) und außerdem Inhaber der Autax-Consilium – Weiterbildung für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. E-Mail: info@uppenbrink.de.
Hinweis: Beachten Sie bitte das Datum dieses Artikels. Er stammt vom 27.05.2021, sodass die Inhalte ggf. nicht mehr dem aktuellsten (Rechts-) Stand entsprechen.